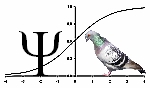|
Übersicht Symptome und StörungsbilderHistorisches Kritik an der Definition des Trauma-Begriffs Risikofaktoren für die Entstehung von PTBS Erklärungsmodelle für PTBS Therapien für die PTBS Psychologisches Debriefing Literatur Symptome und Störungsbilder Bedingung für die Diagnose der PTBS ist das Erleben eines traumatischen Ereignisses. "Traumatisches Ereignis"
im Sinne von DSM-IV ist das Erleben, das Beobachten oder die Konfrontation mit dem tatsächlichen oder drohenden Tod oder einer schweren Verletzung der eigenen Person oder anderer Personen. Dabei erlebt die betroffene Person extreme Angst und fühlt sich hilflos. Traumatische Ereignisse können Kriegserlebnisse, Naturkatastrophen und Unglücksfälle (u.a. Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme, Brände, Flugzeugabstürze, schwere Autounfälle), Folter und körperliche Mißhandlung während einer Inhaftierung sowie das Erleben sein, Opfer eines Sexualverbrechens (sexuelle Mißhandlung, Vergewaltigung) zu werden.
Einige Personen erleben innerhalb von 4 Wochen nach einem traumatischen Ereignis dieses in Bildern, Gedanken, Träumen, Flashbacks oder Illusionen immer wieder (Wiedererleben des Traumas). Sie leiden oft stark darunter, wenn sie Menschen oder Gegenständen begegnen oder an Orten sowie in Situationen sind, die sie an das Ereignis erinnern, und vermeiden daher oft solche Konfrontationen (Furcht- und Vermeidungsreaktionen).Wenn sie zusätzlich sogenannte dissoziative Symptome
wie emotionale Abgestumpftheit, Wahrnehmungsbeeinträchtigungen, Derealisation, Depersonalisation oder eine dissoziative Amnesie entwickeln und starke Ängste oder eine erhöhte körperliche Aktivität zeigen, die sich in Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationssschwierigkeiten, motorischer Unruhe und übertriebenen Schreckreaktionen äußert, dann spricht man von einer Akuten Belastungsreaktion (ICD-10) oder einer Akuten Belastungsstörung (ABS; DSM-IV). Die Akute
Belastungsstörung hält zwischen 2 Tagen und 4 Wochen an. Wenn die Beschwerden innerhalb eines Monats nach dem traumatischen Ereignis nicht verschwunden sind, spricht man von einer Posttraumatischen Belastungsstörung
(PTBS). Zusätzlich zu den Symptomen der ABS findet man bei den Betroffenen der PTBS häufig eine Entfremdung von ihrer Familie, ihren Freunden und Verwandten sowie ihrer gewohnten Umgebung. Sie verlieren oft den Sinn für das Leben und interessieren sich nicht mehr für das, was sie früher gern getan haben. Eine PTBS muß im Gegensatz zu einer ABS nicht unbedingt innerhalb eines Monats nach dem traumatischen Ereignis beginnen, sondern kann auch erst deutlich später einsetzen, ohne daß vorher
Symptome einer ABS oder einer anderen psychischen Störung aufgetreten sind. Leidet die betroffene Person zum ersten Mal unter Beschwerden einer PTBS, nachdem das Ereignis bereits länger als 6 Monate zurückliegt, so spricht man von einer Posttraumatischen Belastungsstörung Mit Verzögertem Beginn. Auch die Dauer einer PTBS ist anders als bei der ABS nicht festgelegt. Man kann allerdings kurz andauernde posttraumatische Belastungsstörungen von lang andauernden posttraumatischen
Belastungsstörungen unterscheiden: Wenn eine PTBS maximal 3 Monate andauert, dann spricht man von einer Akuten Posttraumatischen Belastungsstörung. Dauert sie dagegen länger als 3 Monate an, dann liegt eine Chronische Posttraumatische Belastungsstörung vor. zur ÜbersichtHistorisches
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine relativ neue Störungskategorie und wurde 1980 mit der 3. Fassung des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-III) eingeführt. Vor 1980 war das Störungsbild zwar schon bekannt, aber unscharf definiert und mit verschiedenen Namen belegt worden (z.B. Granatenschock, Kriegsneurose, Vergewaltigungstraumasyndrom). Im Hinblick auf
Streßsymptome, die nach Kampfhandlungen bei Soldaten auftraten, nahmen viele Militärärzte außerdem lange Zeit an, daß diese Symptome nicht von Dauer sein würden. Nach dem Vietnam-Krieg setzten sich allerdings Veteranen-Verbände für die offizielle Aufnahme des Syndroms in das DSM ein und hatten damit schließlich Erfolg.zur Übersicht Kritik an der Definition des Trauma-Begriffs Die Definition des Trauma-Begrifs, wie er im DSM-IV vorgenommen wird, bezieht sich nicht nur auf Personen, die direkt von Tod oder schwerer Verletzung betroffen waren, sondern schließt auch Personen ein, die Tod oder schwere Verletzung bei anderen erlebt haben. Einige Wissenschaftler kritisieren deswegen die Definition, weil sie es
ermöglicht, eine sehr große Gruppe von Personen, die von nicht pathologischen Streßsymptomen betroffen sind, als traumatisiert zu beschreiben. Ein Beispiel ist die Befragung vieler Menschen durch die RAND Corporation nach dem Attentat auf das World Trade Center am 11. September 2001 in New York. Menschen wurden als traumatisiert eingestuft, weil sie dieses Ereignis am Fernseher miterlebten und deshalb Streßsymptome aufwiesen. Dies wird von Kritikern jedoch als unangemessene
Ausdehnung des Begriffes Trauma bezeichnet, da es einen Unterschied geben sollte zwischen diesen Menschen und Menschen, die nach Kriegshandlungen, Vergewaltigungen, KZ-Haft oder Folter unter Streßsymptomen leiden.zur Übersicht Risikofaktoren für die Entstehung von PTBS Obwohl die Anzahl der Personen sehr groß ist, die einmal in ihrem Leben ein traumatisches Ereignis erleben - in einer Zufallsstichprobe von US-Amerikanern betrug die Häufigkeit 60,7% (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995) - liegt die Häufigkeit der Störung selbst nur zwischen 1 - 9%. Dieser Unterschied weist darauf hin, daß das traumatische Ereignis allein nicht für die Entstehung der
Störung verantwortlich ist. Stattdessen gibt es bestimmte Bedingungen, die das Auftreten der Störung begünstigen, und andere, die es unwahrscheinlicher werden lassen. Begünstigende Bedingungen werden als Risikofaktoren bezeichnet. Zu ihnen zählen: - affektive oder Angststörung bei sich oder Familienangehörigen (Breslau et al., 1991; Smith et al., 1990; Davidson et al., 1985),
- neurologische Auffälligkeiten (Gurvits et al., 2000),
- dissoziative Symptome während
des Traumas (Derealisation, Depersonalisation, Deja vu-Erleben, Ruhelosigkeit, Störungen der Zeitwahrnehmung),
- Neurotizismus (Breslau et al., 1991; McFarlane, 1989),
- instabile Familienverhältnisse während der Kindheit (King et al., 1996),
- sexueller Mißbrauch oder Mißhandlung in der Vorgeschichte (Engel et al., 1993; Nishith et al., 2000; Bremner et al., 1993).
Ein weiteres Problem stellt eine geringe soziale Unterstützung der Traumatisierten dar.
Hierbei ist aber unklar, ob die geringe soziale Unterstützung eine Bedingung oder eine Folge der PTBS ist. Höhere Intelligenz gilt dagegen als protektiver Faktor, der das Entstehen einer PTBS unwahrscheinlicher macht. Menschen mit durchschnittlicher Intelligenz erkranken also häufiger an der Störung als Menschen mit höherer Intelligenz. Man nimmt an, daß höher intelligente Personen das traumatische Ereignis besser verarbeiten können und daher seltener erkranken (McNally &
Shin, 1995; Vasterling et al., 1997; 2002; Silva et al., 2000). zur ÜbersichtErklärungsmodelle für PTBS Zur Erklärung von PTBS wurden eine Reihe von Modellen entwickelt. Im folgenden sollen eine psychologische und eine neurobiologische Theorie vorgestellt werden. Zwei-Faktoren-Theorie
Eine Reihe von Wissenschaftlern (z.B. Keane, Zimering & Caddell, 1985; Keane, Fairbank, Caddell, Zimering & Bender, 1985; Kilpatrick, Veronen & Best, 1985; March, 1990; Quirk, 1985) erklärt die Symptome der PTBS mit einer Lerntheorie, der Zwei-Faktoren-Theorie von Mowrer (1947): - Unkonditionierte Reaktionen:
Die Furcht- und Streßreaktionen während des traumatischen Ereignis werden als unkonditionierte Reaktionen aufgefaßt.
- klassische Konditionierung:
Während des Ereignisses waren auch andere, ursprünglich keine Furcht- und Streßreaktionen auslösenden Reize vorhanden. Diese wurden jedoch über klassische Konditionierung zu konditionierten Auslösern von Angst und Streß.- operante Konditionierung:
Die konditionierten Auslöser werden später von den traumatisierten Personen vermieden, so daß diese Personen nicht die Erfahrung machen können, daß diese Reize harmlos sind. Die Angst- und Streßreaktionen werden also negativ verstärkt.- Reizgeneralisierung
: Während anfangs nur Reize, die in der traumatischen Situation vorhanden waren, die PTBS-Symptome auslösen, erhöht sich über einen Generalisierungsprozeß die Zahl der konditionierten Auslöser, unter denen dann auch Reize
sind, die nicht während des traumatischen Ereignisses vorhanden waren.
Mit diesem Modell soll auch die unterschiedliche Schwere von PTBS-Symptomen erklärt werden: Je intensiver die unkonditionierten Reize während der traumatischen Situation waren, desto schwerer sind die Symptome (Dosis-Reaktions-Modell der PTBS; z.B. March, 1993). Diese Erklärung der PTBS ist hinsichtlich mehrerer Aspekte kritisiert worden: - einmaliges Ereignis:
Klassische Konditionierung benötigt meistens mehrere Lerndurchgänge. Es ist daher fraglich, ob ein Ereignis zu klassischer Konditionierung führen kann (Yehuda & Antelman, 1993).- Art der Symptome:
Wiedererleben gehört nicht zu den typischen Angstsymptomen. Wie ist ihr häufiges Auftreten im Rahmen der Zwei-Faktoren-Theorie zu erklären?- kein Rückgang der Symptome trotz ständiger Konfrontation:
Durch das Wiedererleben des Traumas sind die Traumatisierten sehr oft mit den traumatischen Reizen konfrontiert. Dies müßte nach den Lerntheorien zum Rückgang der Symptome führen. Dies geschieht aber nicht. Einige Befürworter der Zwei-Faktoren-Theorie gehen daher von einer nur bruchstückhaften Konfrontation aus, die zudem in einem weniger erregten Zustand erfolgt, so daß die Symptome erhalten bleiben.- Reizgeneralisierung
: Warum sollte dieser Prozeß gerade bei der PTBS eine
solch herausragende Rolle einnehmen? Es wird argumentiert, daß dies von der Schwere der traumatischen Situation und der Komplexität der Reize der Fall ist.- Je schwerer die Streßreize, desto schwerer die Symptome?
Trotz einiger Belege dafür, daß die Symptome einer PTBS umso schwerer sind, je schwerer die traumatische Situation war, gibt es andere Studien, die keinen so einfachen Zusammenhang zeigen. So hängt z.B. die Schwere einer PTBS nach einem Autounfall nicht davon ab, wie schwer der Autounfall war. Auch die Anzahl der Folterungen politischer Aktivisten hängt nicht mit der Schwere ihrer Streßsymptome zusammen.- Verzögerter Beginn:
Wenn die PTBS durch die Zwei-Faktoren-Theorie erklärt wird, warum tritt sie dann nicht sofort auf?
Hypercortisolismus Während einer Streßsituation reagiert der Körper mit der Ausschüttung von Hormonen. Dabei werden unterschiedliche physiologische Systeme angesprochen. Nach Henry und Stephens (1977) unterscheidet man zwischen -
der sympathico-adreno-medullären Achse mit den Hormonen Noradrenalin, Adrenalin und Testosteron,
- der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse mit den Hormonen ACTH und Glucocorticoiden wie z.B. Cortisol.
Bei Kontrollverlust, wie er während eines traumatischen Ereignisses vorliegt, wird v.a. die zweite Achse aktiviert, so daß vermehrt Glucocorticoide ausgeschüttet werden. Diese Hormone sind allerdings für eine Hirnstruktur schädlich, die für die Übernahme von Inhalten in
das Gedächtnis verantwortlich ist: den Hippocampus. Dieser hat aber auch die Aufgabe, die Ausschüttung von Glucocorticoiden zu hemmen. So entsteht ein Teufelskreis: Aufgrund des Streß werden mehr Glucocorticoide ausgeschüttet. Diese schädigen den Hippocampus mit der Folge, daß die Glucocorticoidausschüttung weniger gehemmt wird und noch mehr Glucocorticoide ausgeschüttet werden. Schließlich liegt ein chronisch erhöhter Glucocorticoid-Spiegel (Hypercortisolismus) bei geschädigtem
Hippocampus und Gedächtnisstörungen vor. Dies soll die Gedächtniseffekte bei PTBS erklären. Diese Theorie wurde dadurch gestützt, daß man bei Trauma-Patienten tatsächlich verkleinerte Hippocampi gefunden hat. Allerdings sind die Cortisolspiegel meistens nicht erhöht, sondern normal und manchmal sogar niedriger als bei gesunden Personen. Auch die Erklärung der Gedächtnisstörungen scheint unplausibel: Trauma-Patienten leiden vor allem darunter, daß sie das Trauma immer wieder erleben. Von
einem Gedächtnisverlust aufgrund eines erhöhten Cortisolspiegels und einer Schädigung des Hippocampus kann also nicht die Rede sein. Zudem fand man bei Patienten mit einer organisch verursachten Erhöhung des Cortisolspiegels (Morbus Cushing), daß der Gedächtnisverlust durch Cortisol reversibel ist, wenn die Ursache der Störung (Tumor) beseitigt ist und der Cortisolspiegel sich normalisiert hat. Ein weiteres starkes Argument gegen die Theorie des Hypercortisolismus lieferte eine
Zwillingsstudie von Gilbertson und Kollegen (2002). Die Forscher fanden, daß unter eineiigen Zwillingspaaren, von denen der eine Zwilling in Vietnam kämpfte und eine PTBS bekam, der andere aber nicht, BEIDE Zwillingsbrüder verkleinerte Hippocampi hatten. Dies spricht dafür, daß die Größe des Hippocampus nicht mit dem Trauma zusammenhängt, sondern genetisch festgelegt ist. zur Übersicht Therapien für die PTBS Die Therapieverfahren zur Behandlung von PTBS kann man in vier Gruppen einteilen:- Hypnotherapie (Hypnose),
- psychodynamische Psychotherapie (u.a. Psychoanalyse)
- kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren (u.a.
Systematische Desensibilisierung, verlängerte Reizkonfrontation, Streßimpfungstraining, Cognitive Processing Therapy)
medikamentöse Behandlung: Anxiolytika und Antidepressiva (v.a. selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer).Aufgrund kritischer Untersuchungen von Qualitätskriterien zur Wirksamkeit der ersten drei Therapieverfahren zogen Foa und Meadows (1997) in ihrem Überblicksartikel folgenden Schluß: - Viele Studien zur Qualität der Behandlung von PTBS sind methodisch unbefriedigend. Dies liegt z.T. daran, daß die PTBS eine relativ neue Störungskategorie ist und daher bis
zum damaligen Zeitpunkt noch wenig Forschung in dem Bereich betrieben wurde.
- Kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden
wurden am häufigsten und am strengsten in qualitativ hochwertigen Studien überprüft. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen,
Reizkonfrontation als auch Streßimpfungstraining effektive Behandlungsmethoden der PTBS sind,
Untersuchungen zur Cognitive Processing Therapie, einem kombinierten Verfahren aus Reizkonfrontation und kognitiver Restrukturierung, vielversprechende Ergebnisse aufweisen, dieses Verfahren aber genauer untersucht werden muß, Studien zum Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), einer speziellen Form der Reizkonfrontation, methodisch äußerst unzulänglich sind, so daß die Effektivität und Effizienz dieser Methode nicht beurteilt werden kann.
Therapien, die kombiniert verhaltenstherapeutische Techniken einsetzen, anscheinend nicht erfolgreicher als Programme sind, die nur auf eine Technik setzen.daß sich von den verschiedenen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Techniken die verlängerte Reizkonfrontation als bestes Verfahren herausgestellt hat: Die meisten Studien belegen ihre Wirksamkeit, sie ist einfach einzusetzen und Therapeuten können sie schnell erlernen.Therapien, die nicht zu den
kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren zählen, wurden nur selten und wenn, dann methodisch unzulänglich überprüft, so daß kein Urteil über die Qualität der Verfahren möglich ist. Die einzige qualitativ höherwertige Studie (Brom und Kollegen, 1989) zu diesen Verfahren verglich Hypnotherapie mit Systematischer Desensibilisierung
(verhaltenstherapeutisches Verfahren) und einer psychodynamischen Kurzzeittherapie. Mit Hilfe aller drei Verfahren konnten die Symptome der PTBS gemildert werden. Die durchschnittliche Reduktion der Symptomschwere, erhoben mit einem Selbsteinschätzungsfragebogen, war bei der Systematischen Desensibilisierung mit 41% am höchsten, gefolgt von der Hypnotherapie mit 34% und der psychodynamischen Kurzzeittherapie mit 29%.Van Etten und Taylor (1998) führten eine Meta-Analyse von 61
Therapiestudien zu PTBS im Erwachsenenalter durch. Eingeschlossen waren Kognitive Verhaltenstherapie, EMDR, Entspannungsverfahren, Hypnotherapie, psychodynamische Therapien und medikamentöse Therapien. Als Kontrollen standen Placebo, Wartelisten und supportive Therapien zur Verfügung. Die Ergebnisse der Meta-Analyse zeigten, daß psychotherapeutische Verfahren zu einer geringeren Abbruchrate als medikamentöse Behandlungen führten (14 vs. 32 Prozent) und daß Patienten, die mit kognitiver
Verhaltenstherapie oder EMDR behandelt waren, noch 15 Wochen nach Therapieende Behandlungserfolge aufwiesen. In einer Meta-Analyse von Davidson und Parker (2001) zeigte sich kein signifikanter Unterschied im Therapieerfolg von EMDR-Behandlungen im Vergleich zu kognitiver Verhaltenstherapie. Außerdem sind die sakkadischen Augenbewegungen der EMDR-Therapie anscheinend nicht für den Behandlungserfolg notwendig und erbringen auch keinen Zusatznutzen. EMDR-Behandlungen ohne Augenbewegungen
erzielen den gleichen Therapieerfolg wie EMDR-Behandlungen mit Augenbewegungen. Anscheinend beruht der Erfolg der EMDR ausschließlich auf der Verwendung kognitiv-verhaltenstherapeutischer Behandlungselemente. zur Übersicht Psychologisches Debriefing Unter psychologischem Debriefing versteht man einmalig durchgeführte, kurze psychologische Gespräche mit traumatisierten Personen innerhalb von 48
Stunden nach dem traumatischen Ereignis. Diese Form der “Krisenintervention” wird häufig angewendet und soll die Belastung der Opfer vermindung und der Entwicklung einer PTBS vorbeugen. In einer Meta-Analyse von Rose, Bisson und Wessely (2003), in die 11 Studien einbezogen wurden, zeigte sich jedoch keine positive Wirkung von Debriefing: Weder ließen sich Angst, depressive Stimmung und Streß noch das Risiko einer PTBS durch Debriefing verringern. In einer der einbezogenen Studien wurde sogar
ein erhöhtes Risiko für das Entstehen einer PTBS in Folge von psychologischem Debriefing gefunden. zur Übersicht Literatur Cottraux, J. (2005). Nicht-medikamentöse Behandlung von Angsterkrankungen. In M. Lader (Hrsg.), Psychiatrie-Highlights 2003 2004. München: Urban & Fischer.
Foa, E. B. & Meadows, E. A. (1997). Psychosocial Treatments for Posttraumatic Stress Disorder: A Critical Review. Annual Review of Psychology, 48, 449-480. McNally, R. J. (2003). Progress and Controversy in the Study of Posttraumatic Stress Disorder. Annual Review of Psychology, 54, 229-252. zur Übersicht |