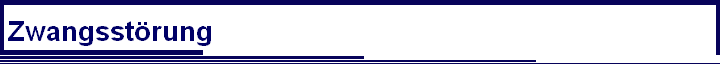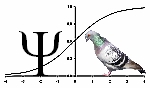| Übersicht Symptome Verlauf Vermutete Ursachen Therapie Symptome Menschen mit Zwangsstörung leiden unter Zwangsgedanken und / oder Zwangshandlungen. Zwangsgedanken stellen keine übertriebenen Sorgen über schwierige Lebenssituationen dar, sondern sind wiederholt sich gegen den Willen und die Überzeugung der Betroffenen aufdrängende Gedanken mit oft obszönen oder aggressiven Inhalten, die als unangemessen
empfunden werden und starke Angst oder Unbehagen auslösen. Die Ängste können entweder die Form unbestimmter Sorgen oder konkreter Vorstellungen annehmen, daß etwas Schlimmes geschehen wird (Zwangsbefürchtung). Sie können auch als Panikattacken in Erscheinung treten. Neben den Zwangsgedanken treten oft zwanghafte Impulse
auf, obszöne oder aggressive Handlungen auszuführen. Gegen ihre Zwangsgedanken und -impulse kämpfen Zwangspatienten typischerweise an: Sie versuchen sie zu ignorieren, zu unterdrücken oder mit Hilfe anderer Gedanken oder Handlungen zu neutralisieren. Damit gehen oft Zwangshandlungen einher, die im späteren Verlauf der Störung oft zu Zwangsritualen
systematisiert sind. Die Betroffenen müssen dann bei Auftreten von Zwangsgedanken und -impulsen in starr festgelegter Reihenfolge oder nach Schemata bestimmte Gedanken denken und Handlungen ausführen, mit denen die entstandenen Ängste abgebaut oder die befürchteten Ereignisse verhindert werden sollen. Die Rituale können Zeiträume von Stunden andauern und müssen oft, falls die Betroffenen durch irgend etwas abgelenkt oder gestört werden, von Anfang an wiederholt werden.
Zwangshandlungen und Zwangsgedanken treten in typischer Form in Erscheinung. Zwangsgedanken (obsessions) | Zwangshandlungen (compulsions) | Zwangsvorstellungen, Zwangsimpulse, Zwangsideen, zwanghaftes
Grübeln | Zwangshandlung, Zwangsritual | - Schmutz, Ansteckung (66%)
- Aggression, Verletzung, Tötung (25%)
- Ordnung (25%)
- Religion (10%)
- Sexualität (5%)
| Reinlichkeitszwang, Kontrollzwang, Ordnungszwang, Berührzwang, verbale Rituale, Zählzwang, Eßzwang |
In den meisten Fällen leiden Zwangspatienten sowohl unter Zwangsgedanken als auch Zwangshandlungen. Nach Angaben von Welner und Mitarbeitern (1976) tritt die Kombination in ca. 69% der Fälle auf. In 25% aller Fälle hat man es mit Zwangsgedanken allein zu tun und bei 6% der Fälle sind nur Zwangshandlungen ohne Zwangsgedanken zu beobachten. Zusätzlich leiden Zwangspatienten meistens
auch an mit den Symptomen in Verbindung stehenden Phobien, wie z.B. der Furcht vor Ansteckung bei Kontaminationszwängen. Die Zwangsstörung wird im DSM-IV unter die Angststörungen subsumiert, weil Zwangsgedanken eine intensive Angst auslösen oder diese mit Zwangshandlungen und Zwangsgedanken vermieden werden. Außerdem verstärkt sich die Angst, wenn die Patienten
versuchen, ihren Zwängen Widerstand entgegen zu setzen. Nach Ferstl stellen die Angststörungen jedoch die falsche Oberkategorie für die Zwangsstörung dar, weil Zwänge nicht mit Vermeidungsverhalten einhergehen, sondern die Wiederholungen eher auf eine neurobiologische Störung hinweisen. Sie sollten daher in einer eigenen Störungskategorie (wie in der ICD-10) oder als
Impulskontrollstörung klassifiziert werden. Hier wird dieser Kritik an der Klassifikation im DSM-IV Rechnung getragen, indem die Zwangsstörung einen von den Angststörungen separaten Abschnitt erhält. zur Übersicht Verlauf von Zwangsstörungen
Im Mittel liegt das Ersterkrankungsalter zwischen 20 und 30 Jahren und bei drei Viertel der Zwangspatienten trat die Störung bis zum 30. Lebensjahr auf. Allerdings erkrankt ein Drittel der Betroffenen bereits im Alter von 15 Jahren. Die Störung beginnt meistens mit wenigen und nur schwach ausgeprägten Symptomen, deren Zahl und Intensität sich über Monate und Jahre bis zum vollausgeprägten
Bild weiterentwickeln. Häufig ist kein belastendes oder auslösendes Lebensereignis feststellbar. Aus diesem Grund nehmen viele Betroffene viele Jahre keine ärztliche und psychotherapeutische Behandlung in Anspruch. Wenn die Störung nicht behandelt wird, verläuft sie in zwei Drittel der Fälle chronisch und erreicht bei 15% massivste Zustände, die Stupor und Mutismus (Bewegungslosigkeit /
Verlust der Sprechfähigkeit) einschließen können. Bei manchen Patienten verschwindet auch die Einsicht, daß die Zwangsgedanken und -handlungen unangemessen und irrational sind. In diesen Fällen ist es kaum mehr möglich, Zwänge von psychotischem Wahn zu unterscheiden. Ein Drittel der unbehandelten Fälle erreicht einen Zustand, in dem die Störung in Streßsituationen verstärkt auftritt.Wenn die Störung geeignet behandelt wird (siehe Therapie
), dann wird bei ca. 50-60% der Fälle eine Milderung der Symptome und eine Besserung im Verlauf erreicht. Allerdings tritt meistens keine vollständige Symptomfreiheit (Vollremission) auf. zur Übersicht Vermutete Ursachen Die Ursachen der Zwangsstörung sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Es gibt jedoch wie bei vielen anderen Störungen auch eine Reihe
von Erklärungsansätzen. Die klassische psychoanalytische Theorie sieht neurotische Mechanismen als für die Störung verantwortlich an und spricht daher von einer Zwangsneurose. Sie geht von einer Fixierung von Anteilen der Libido (“Sexualenergie”) auf Objekten und Handlungen aus, die während der analen Entwicklungsphase (2. und 3. Lebensjahr) von Bedeutung waren. Nach traumatischen oder krisenhaften
Erlebnissen im Jugend- und Erwachsenenalter soll es zu einer Regression der Sexualorganisation auf diese Entwicklungsstufe kommen, wodurch Gedanken, Vorstellungen und Impulse aus dem Es ins Bewußtsein drängen. Das Ich - so diese psychoanalytische Auffassung - reagiert begünstigt durch ein sehr starkes Über-Ich auf diese Gedanken mit Angst und Unbehagen sowie mit Methoden der Abwehr
wie der Isolierung der befürchteten Gedanken, dem Ungeschehenmachen in Form von Zwangsritualen und der Reaktionsbildung, bei der den Es-Impulsen entgegengesetzte Gedanken und Handlungen ausgeführt werden. Bislang gibt es für die psychoanalytische Sichtweise der Zwangsstörung keine ausreichenden empirischen Belege. Im Gegensatz dazu steht für das klassisch verhaltenstherapeutische Modell Vermeidungslernen im Vordergrund (z.B. nach der Zwei-Faktoren-Theorie
nach Mowrer). Diesem Modell zufolge lernen Zwangspatienten, in ihnen stark unangenehmen, krisenhaften Situationen zu fliehen und Situationen zu vermeiden, die sie mit diesen unangenehmen Situationen verbinden. Dieses Verhaltensmuster soll sich über den Mechanismus der negativen Verstärkung verfestigen und schließlich die Form von Zwangsritualen annehmen. Empirische Belege für diese Art der Störungsentwicklung stammen v.a. aus Tierexperimenten. Als Hauptkritikpunkte an diesem
Krankheitsmodell werden v.a. das Fehlen von krisenhaften auslösenden Situationen und Ereignissen bei vielen Zwangspatienten und die mangelnde Erklärungsmöglichkeit für Zwangsgedanken angeführt. Kognitive Theorien verstehen die Zwangsstörung nicht als Störung von Angst oder Affekt. Sie sehen sie vielmehr als Ausdruck “fehlangepaßter Arten des Denkens, des Schlußfolgerns, der Aufnahme, Verarbeitung und Assimilation von Informationen” (Reed,
1985) an. Eine Hauptrichtung dieser Ansätze vermutet die Ursache in einer Störung der metakognitiven Regulation (“Überwachung”) des eigenen Gedankenstroms (Purdon & Clark, 1999): Zwangsgedanken werden als übersteigerte Form nichtpathologischer aufdringlicher Gedanken konzeptualisiert. Aufgrund einer unangemessenen Bewertung der nichtpathologischen Gedanken werden diese
von Zwangspatienten als bedeutsam und bedrohlich erlebt und führen bei ihnen zu Angst und Unbehagen. Die übermäßige Bewertung soll diesen Theorien zufolge durch die Entwicklungsgeschichte, eine biologische Disposition und in Streßsituationen zustande kommen. Gegen die Angst und die unangenehmen Gefühle werden nach diesem Modell wiederum Neutralisierungstechniken eingesetzt (z.B. Salkovskis, 1985, 1989, 1998; Rachman, 1997, 1998; Wells, 1997). Szechtman und Woody (2004) haben eine
motivationale Theorie zur Genese der Zwangsstörung vorgeschlagen: Ihrer Theorie zufolge verfügen Menschen über ein motivationales System, das bei wahrgenommener potentieller Bedrohung für die eigene oder andere Personen aktiviert wird. Bei Aktivierung werden sowohl Angst als auch physiologische Prozesse und Verhaltensweisen ausgelöst. Durch diese Reaktionen wird der Theorie zufolge die Wiederherstellung von Sicherheit angestrebt. Die Aktivitäten des
motivationalen Systems enden, wenn ein Gefühl des Wissens (Yedasentience) um Sicherheit besteht. Szechtman und Woody (2004) nehmen nun an, daß bei Zwangsgestörten das Gefühl des Wissens nicht eintritt, so daß das Sicherheitsmotivationssystem nicht deaktiviert wird. Damit erklären sie, daß Zwangsgestörte Handlungen wie Waschen, Putzen, Kontrollieren usw. immer wieder
ausführen, weil sie trotz des Wissens, daß sie diese Handlungen ausgeführt haben, kein Gefühl dafür haben, daß sie sie tatsächlich ausgeführt haben. Die Zwangsstörung wird auch mit neuropsychologischen Fehlfunktionen in Zusammenhang gebraucht. Bei Zwangspatienten zeigen sich Auffälligkeiten im orbitofrontalen Cortex, in den Basalganglien (v.a. Nucleus caudatus und Putamen) und im Thalamus.
Neurophysiologisch bilden die Orbitalregion der Stirnrinde und der Nucleus caudatus einen Schaltkreis, der die Umwandlung eines sensorischen Inputs in Kognitionen und Aktionen steuert: In der Orbitalregion entstehen u.a. Nervenimpulse, die mit Ausscheidung, Sexualität, Gewalt und anderen primitiven Aktivitäten zusammenhängen. Die Impulse werden an den Nucleus caudatus gesendet, der
Filter nur die stärksten von ihnen zum Thalamus passieren läßt. Wenn die Impulse im Thalamus empfangen werden, fühlt sich die Person gedrängt, weiter über die mit ihnen verknüpften Inhalte nachzudenken. Bei der Zwangsstörung deuten Untersuchungsbefunde nun darauf hin, daß entweder die Orbitalregion oder der Nucleus caudatus überaktiv sind, so daß ständig Nervenimpulse diese Hirnregionen passieren, die mit beunruhigenden Gedanken und Handlungen zusammenhängen.
Bloom (1988) lokalisierte den Ort der Fehlfunktion in den Basalganglien, wo der Abgleich zwischen Befehl und Ausführung bzw. zwischen visueller und motorischer Wahrnehmung gestört sein soll, so daß es zu Handlungen kommt, die ständig wiederholt werden. Über die Annahme motorischer Anteile auch bei Zwangsgedanken können diese ebenfalls mit dieser Theorie erklärt werden (subvokale Sprechperseverationen)
. Eine Bestätigung erfuhr Blooms Theorie durch das Entstehen oder Verschwinden von Zwangssymptomen in Zusammenhang mit Unfällen, Krankheiten oder gescheiterten Suizidversuchen. In einem Fall schoß sich z.B. ein Mann wegen seiner quälenden Zwangssymptomatik in den Kopf, woraufhin die Symptome verschwanden. Eine Modifikation der Basalganglien-Theorie wurde aufgrund der Befunde einer Positronenemissionstomographie (PET)-Studie
von Rauch und Mitarbeitern (1994) notwendig. Bei diesen Untersuchungen fanden die Forscher, daß nicht nur die Basalganglien, sondern auch der Stoffwechsel im anterioren Cingulum und im orbitofrontalen Cortex erhöht ist. Aufgrund dieser Befunde wurde die Theorie der gestörten Basalganglien dahingehend verändert, daß eine Störung des fronto-striatalen Kreislaufs
angenommen wurde. Dies ist mit einer Störung der Exekutivfunktionen (u.a. Überwachung und Koordinierung von Handlungen) vereinbar. Eine andere neurobiologische Theorie basiert auf der Wirksamkeit von Serotonin-Wiederaufnahmehemmern bei Zwangspatienten. So mindert z.B. das Antidepressivum Clomipramin die Zwangssymptome, evtl. weil es die Serotoninaktivität erhöht. Serotoninantagonisten
verstärken dagegen die Zwangssymptomatik. Da Serotonin in den Basalganglien und im Cortex eine wichtige Rolle spielt, könnte eine verringerte Serotoninaktivität einen Einfluß auf die entsprechenden Funktionen der genannten Hirnregionen haben und einen Aspekt der Zwangsstörung darstellen. Isoliert stellt die Serotonin-Mangel-Hypothese jedoch keine Erklärung der Zwangsstörung dar. zur Übersicht
Therapie der Zwangsstörung Therapieaussichten Kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren Medikamentöse Behandlung Therapieaussichten
Zwangsstörungen weisen die ungünstigsten Therapieaussichten von allen Angststörungen auf, was in der hohen Rückfallquote zum Ausdruck kommt. Die Rückfallquote hängt u.U. mit der Dauer der Störung vor Beginn der Therapie zusammen. Eine gute Prognose haben Zwangspatienten mit einem guten Gesundheitszustand vor Ausbruch der Störung, leichten Symptomen, einem episodischen Verlauf der Störung und dem Vorliegen von Lebenskrisen, die mit dem Ausbruch der Störung in Zusammenhang zu stehen scheinen.
Eine schlechte Prognose haben dagegen Patienten, die vor Ausbruch der Störung eine Persönlichkeitsstörung aufwiesen, schlecht in die Gesellschaft integriert waren, überwertige Ideen haben und deren Symptome eine hohe Intensität aufweist. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren
Obwohl ihr Krankheitsmodell wahrscheinlich unzutreffend ist, zeigen kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren im Gegensatz zu psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Therapien recht gute Erfolgsraten. In der kognitiven VT der Zwangsstörung wird mit verschiedenen Verfahren differenziert auf Zwangshandlungen und Zwangsgedanken eingegangen.Klassische Konfrontationsmethoden (Exposition und Reaktionsverhinderung)
sind v.a. bei Zwangshandlungen indiziert. Sie beruhen auf dem Prinzip der Angstlöschung. In der Therapie werden angstbesetzte Situationen aufgesucht – ggf. nachdem der Therapeut es vorgemacht hat – und durch vorher eingeübte Entspannungstechniken oder kognitive Strategien möglichst lange ausgehalten. Der Patient
erlebt dadurch, daß eine Reduktion seiner Angst und Unruhe im Laufe der Zeit eintritt, ohne daß er seine Zwangshandlungen durchgeführt hat. Im Verlauf der Therapie soll der Patient lernen, allein die Angst auslösenden Situationen zu bewältigen, ohne dazu Zwangsgedanken oder -handlungen auszuführen. Bei Zwangsgedanken sind v.a. kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden angemessen, zu denen das Habituationstraining und die kognitive Umstrukturierung unangemessener Überzeugungen gehören. Beim
Habituationstraining werden absichtlich Zwangsgedanken hervorgerufen. Durch eine intensive Konfrontation mit diesen Gedanken bei gleichzeitiger Verhinderung von Neutralisierungstechniken sollen die Gedanken ihre Bedrohlichkeit verlieren. So wird z.B. mit einer Mutter, die zwanghaft daran denken muß, ihre Kinder mit einem Messer zu verletzen, geübt, diesen Zwangsgedanken nicht mehr zu unterdrücken, sondern in Gegenwart
eines sichtbar vor ihr liegenden Messers so lange den Zwangsgedanken zu ertragen, bis der Zwangsgedanke von selbst verschwindet. Nach Ansicht von Clark und Purdon (1993) ist auch eine kognitive Umstrukturierung unangemessener Überzeugungen in die Therapie miteinzubeziehen. Die Therapeuten sollen dabei die Patienten anleiten, ihre zugrundeliegenden unangemessenen
Überzeugungen, z.B. daß negative Gedanken ein Zeichen dafür sind, daß die Patienten böse sind, in Frage zu stellen und zu ändern. Untersuchungen zur Wirksamkeit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Verfahren zeigen eine Überlegenheit der Konfrontationsverfahren gegenüber unspezifischer psychologischer Behandlung mit Entspannungsverfahren. Kognitive Verfahren weisen die gleiche Wirksamkeit
auf (Übersichtsstudie von Abramowitz, 1997). Die Studienergebnisse deuten auf Besserungen bei 60-80% der behandelten Patienten hin. Nachgewiesen wurden die Abnahme der Häufigkeit von Zwangshandlungen und den darauf folgenden Angsterlebnissen, auch eine Reduktion des zwanghaften Denkens, ein besserer Anpassungsgrad an die Familiensituation, im Sozialleben und im Beruf. Diese
Besserungen bleiben nachweislich über Zeiträume von 2 bis 6 Jahren bestehen. Bei ca. 55% der Patienten kann man sogar von sehr guten Besserungen sprechen. Allerdings wird selten ein vollständiger Rückgang der Symptome erreicht. Bei ca. 25% kommt es sogar zu keiner Besserung. Medikamentöse Behandlung
Bei Zwangsstörung ist eine Behandlung mit Antidepressiva wirksam, welche die Wiederaufnahme des Neurotransmitters Serotonin hemmen (sogenannte Serotoninwiederaufnahmehemmer). Dabei ist es für die Wirksamkeit unerheblich, ob es sich um unspezifische (Clomipramin) oder spezifische Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI; z.B. Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin) handelt. Allerdings tritt
die Wirkung dieser Antidepressiva nur ein, wenn sie gleichzeitig die Stoffwechselaktivität in der Orbitalregion der frontalen Hirnrinde und in den Nuclei caudati auf normale Werte senken. Zudem stellt sich die Wirkung überwiegend bei im Vergleich zur Depressionsbehandlung
erhöhten Dosierungen und längerer Mindesteinnahmezeit (6 bis 8 Wochen) ein. Unter diesen Bedingungen zeigen ca. 50 - 85% der Zwangspatienten Besserungen in Kontrast zu 5% Besserungen bei Gabe eines Placebos. Die Zwangssymptome verringern sich im Lauf einer achtwöchigen Therapie um durchschnittlich 40 - 50%. Nach Absetzen der Medikamente kommt es allerdings meistens zu Rückfällen, weshalb eine Kombination der Antidepressiva-Medikation mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren
angeraten wird. zur Übersicht |